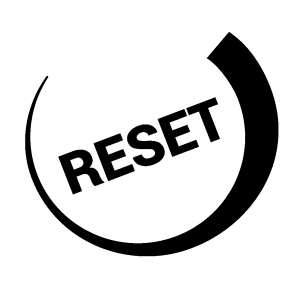DIE GESCHICHTE ZU DEN GESCHICHTEN
MÄRCHEN,FABELN, GLEICHNISSE,WEISHEITEN
GESCHICHTEN HABEN FÜR MICH
Ich liebe Geschichten! Wer erinnert sich jetzt nicht auch an eine schöne Situation, in der man als Kind von den Eltern, den Großeltern oder den größeren Geschwistern eine spannende Geschichte vorgelesen bekommen hat. Gleich ist dieses Gefühl von damals wieder da… treibt einem ein Schmunzeln auf die Lippen.
Geschichten sind Seelentröster, Ablenkung, Mutmacher, Einschlafhilfen. Sie machten neugierig auf all die Abendteuer des Lebens. Für mich habe ich Geschichten vorlesen und auch das Geschichtenerzählen wieder neu – für mich und meine Arbeit – entdeckt. Hier entsteht im Laufe der Zeit hoffentlich zusammen mit den Buchvorschlägen in meinem Blog eine schöne Sammlung unterschiedlichster Geschichten aus unterschiedlichsten Büchern. Also deshalb…..
IMMER MAL WIEDER REINSCHAUEN UND STÖBERN, WAS ES NEUES GIBT
NEHMEN SIE SICH ETWAS ZEIT, MACHEN SIE ES SICH GEMÜTLICH UND …..
ES WAR EINMAL VOR NOCH GAR NICHT LÄNGER ZEIT ….
Achtsamkeit
Einmal kam ein Mann zum Meister. Er bat ihn darum, ihm einige Weisheiten aufs Papier zu schreiben, damit er sie mitnehmen und immer wieder darauf schauen könnte.
Der Meister nahm einen Pinsel zur Hand und schrieb nur ein einziges Wort auf: „Achtsamkeit“.
Der Mann schaute enttäuscht.
„Das kann doch nicht alles sein, oder? Bitte schreib noch etwas dazu.“
Wieder griff der Meister zum Pinsel und schrieb „Achtsamkeit. Achtsamkeit.“
„Vergebt mir, aber das scheint mir weder sehr weise noch tiefsinnig zu sein.“ sagte der Mann.
Daraufhin schrieb der Meister: „Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit“.
Der Mann fühlte sich vom Meister veralbert und wurde wütend.
„Was soll denn Achtsamkeit überhaupt bedeuten?“ rief er.
Da sagte der Meister: „Achtsamkeit heißt Achtsamkeit.“
The three pillars von Zen“ (umgeschrieben)
Philip Kapleau
Die drei wunderbaren Antworten
Vor langer Zeit lebte ein Kaiser, der nach einer Lebensphilosophie Ausschau hielt. Er brauchte Weisheit, um in seinem Land zu beherrschen. Religionen und Philosophien seiner Zeit entsprachen nicht seinen Ansprüchen und seinem Zeitgeist. So überlegte er lange und suchte seine Weisheit in seiner Lebenserfahrung und in der Natur seiner Umgebung zu finden. Irgendwann erkannte er, dass er nur drei Antworten auf seine drei grundlegenden Fragen benötigte, um diese vollkommene Weisheit zu erlangen:
- Welche Zeit ist die beste für jede Sache?
- Welche Menschen sind die wichtigsten, mit denen es gilt zusammen zu arbeiten?
- Welches ist die wichtigste Sache, die man stets tun sollte?
Der Kaiser gab in seinem Reich eine Bekanntmachung heraus, nach der Jeden, der diese Fragen beantworten könne, reichlich belohnt werden sollte. Darauf machten sich viele, die diese Bekanntmachung lasen, sogleich auf den Weg zum Palast des Kaisers. Jeder hatte eine andere Antwort auf diese drei Fragen. So sagte einer, als Antwort auf die erste Frage, der Kaiser solle sich einen genauen Zeitplan machen und jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr für bestimmte Aufgaben festlegen und diesen Plan dann genauestens befolgen. Nur so könne er hoffen, jede Aufgabe zur rechten Zeit zu erfüllen. Ein anderer meinte, es sei unmöglich, alles im Voraus zu planen, der Kaiser solle daher alle nichtigen Vergnügungen lassen und seine Aufmerksamkeit auf jede einzelne Sache richten, um so zu wissen, was er tun solle. Ein weiterer bestand darauf, dass er die Einrichtung eines Rates von Weisen brauche, deren Ratschläge er dann befolgen solle. Wiederum gab einer zu bedenken, dass gewisse Angelegenheiten eine sofortige Entscheidung forderten und es keine Zeit für lange Beratung gäbe. Um im Voraus zu wissen, was geschehen würde, solle er Zauberer und Wahrsager befragen.
Auch in der Beantwortung der zweiten Frage herrschte keine Übereinstimmung. So sagte einer, der Kaiser solle all sein Vertrauen in Verwalter setzen, ein anderer drängte darauf, sich auf Priester und Mönche zu stützen, andere empfahlen Ärzte. Eine ähnliche Vielfalt von Antworten brachte die dritte Frage. Einer sagte, die Wissenschaften seien das Wichtigste, womit es sich zu befassen gelte. Andere bestanden auf der Religion. Und wieder andere behaupteten, das Wichtigste sei die Kriegskunst.
Der Kaiser war jedoch mit keiner der Antworten zufrieden und so gab es keine Belohnung.
Nachdem er einige Nächte mit Nachdenken zugebracht hatte, beschloss der Kaiser, einen Einsiedler aufzusuchen, von dem es hieß, er sei erleuchtet. Der Kaiser wollte dem Einsiedler die drei Fragen stellen. Da er wusste, dass der Einsiedler die Berge nie verließ und bekannt dafür war, nichts mit wohlhabenden oder mächtigen Menschen zu tun haben zu wollen und nur den Armen Gehör schenkte, verkleidete sich der Kaiser als einfacher Bauer. Seinen Dienern befahl er, am Fuße des Berges auf ihn zu warten während er sich allein auf den Weg machte, den Einsiedler zu suchen.
Schließlich erreichte er die Unterkunft des heiligen Mannes. Der Einsiedler war gerade dabei einen Garten anzulegen. Er sah den Fremden, begrüßte ihn mit einem kurzen Kopfnicken und grub weiter. Offensichtlich fiel ihm die Arbeit schwer. Er war ein alter Mann und jedes Mal, wenn er seinen Spaten in den Boden stieß, um Erde auszuheben, atmete er schwer. Der Kaiser näherte sich ihm und sprach: „Ich bin hierhergekommen, um deine Hilfe bei drei Fragen zu erbitten:
Welche Zeit ist die beste für jede Sache?
Welche Menschen sind die wichtigsten, mit denen es zusammenzuarbeiten gilt?
Und was ist die wichtigste Sache, die man stets tun sollte?“
Der Einsiedler hörte aufmerksam zu, klopfte dem Kaiser aber nur auf die Schulter und grub weiter.
Der Kaiser sagte: „Du musst müde sein, lass mich dir beim Graben helfen“. Der Einsiedler dankte ihm, gab dem Kaiser den Spaten und setzte sich zum Ausruhen auf die Erde.
Als er zwei Beete umgegraben hatte, hielt der Kaiser inne, wandte sich an den Einsiedler und wiederholte seine drei Fragen. Der Einsiedler antwortete ihm immer noch nicht, stand stattdessen auf, deutete auf den Spaten und sagte: „Ruh dich auch einmal aus. Ich kann jetzt wieder weitermachen.“ Der Kaiser fuhr jedoch fort zu graben. Es verging eine Stunde und eine zweite. Schließlich begann die Sonne hinter den Bergen unterzugehen. Der Kaiser setzte den Spaten nieder und sagte zu dem Einsiedler: „Ich kam her, um dich zu fragen, ob du mir meine drei Fragen beantworten kannst. Wenn du jedoch keine Antworten für mich hast, so lasse es mich wissen, damit ich mich auf den Weg nach Hause machen kann.“ Der Einsiedler hob seinen Kopf und fragte den Kaiser: „Hörst du dort drüben jemanden rennen?“ Der Kaiser wandte seinen Kopf. Beide sahen einen Mann mit einem langen weißen Bart aus einem Waldstück hervortreten und auf sie zulaufen. Er hielt seine Hände gegen eine blutende Wunde an seinem Bauch gepresst. Vor dem Kaiser fiel der Mann ohnmächtig zu Boden und stöhnte. Sie öffneten die Kleider des Mannes und der Kaiser und der Einsiedler sahen, dass der Mann eine tiefe Bauchwunde hatte. Der Kaiser reinigte die Wunde sorgfältig und verband sie mit seinem eigenen Hemd, das sich sofort mit dem Blut vollsaugte. Er wrang das Hemd aus und verband ihn ein zweites Mal. Schließlich erlangte der Mann sein Bewusstsein wieder und bat um einen Schluck Wasser. Der Kaiser eilte zum Bach und brachte einen Krug mit frischem Wasser.
Inzwischen war die Sonne untergegangen, die Nachtluft war kalt. Der Einsiedler half dem Kaiser, den Mann in seine Hütte zu tragen und auf sein Bett zu legen. Der Mann schloss die Augen und lag ganz ruhig da. Der Kaiser war nun sehr müde geworden nach diesem langen Tag, angestrengt vom Aufstieg auf dem Berg und vom Graben im Garten. Er lehnte sich gegen den Türpfosten und schlief ein. Als er erwachte war die Sonne schon über den Bergen aufgegangen. Für einen Augenblick wusste er nicht, wo er war und warum er gekommen war. Er wandte seinen Blick zum Bett und sah, dass auch der Verwundete verwirrt um sich schaute. Als dieser den Kaiser erblickte, schaute er ihn eindringlich an und sagte mit kaum hörbarem Flüstern: „Vergebt mir.“
„Was hast Du getan, das ich dir verzeihen sollte?“ fragte der Kaiser.
„Ihr kennt mich nicht, Eure Majestät, aber ich kenne Euch. Ich war Euer eingeschworener Feind, und ich hatte gelobt, mich an Euch zu rächen, denn im letzten Krieg habt Ihr meinen Bruder getötet und meinen Besitz an Euch gebracht. Als ich hörte, dass Ihr allein auf den Berg kommen würdet, beschloss ich, Euch auf dem Rückweg aufzulauern und Euch zu töten. Nachdem ich jedoch lange gewartet hatte und immer noch nichts von Euch zu sehen war, verließ ich meinen Hinterhalt, um Euch zu suchen. Statt auf Euch, traf ich jedoch auf Eure Diener, die mich erkannten und mich verwundeten. Glücklicherweise konnte ich entfliehen und eilte hierher. Hätte ich Euch nicht angetroffen, wäre ich jetzt sicherlich tot. – Ich hatte vor Euch zu töten und nun habt Ihr mir stattdessen das Leben gerettet! Ich bin beschämt und weiß gar nicht wie ich meine Dankbarkeit in Worte fassen kann. Wenn ich am Leben bleibe, gelobe ich, Euch für den Rest meines Lebens zu dienen und ich werden meine Kinder und Kindeskinder anweisen, es ebenso zu tun.“
Der Kaiser war überaus erfreut darüber. Wie leicht er sich mit seinem früheren Feind aussöhnen konnte. Er vergab diesem Mann nicht nur, sondern versprach, ihm all seinen Besitz zurückzugeben und seinen Leibarzt und seine Bediensteten zu ihm zu schicken, damit sie ihn bis zu völligen Genesung pflegten. Nachdem er seinen Dienern aufgetragen hatte, den Mann nach Hause zu bringen, wollte der Kaiser ein letztes Mal mit dem Einsiedler sprechen. Denn bevor er in seinen Palast zurückkehrte, wollte er seine drei Fragen noch einmal wiederholen.
Als er beim Einsiedler ankam, war dieser gerade dabei, Samen in die Erde zu säen, die sie am Tag zuvor umgegraben hatten. Der Einsiedler stand auf und schaute den Kaiser an: „Aber Eure Fragen wurden doch bereits beantwortet.“
„Wie das?“ fragte der Kaiser voller Staunen.
„Hättet Ihr gestern nicht Mitleid mit meinem Alter gehabt und mir geholfen, diese Beete anzulegen, hätte Euch der Mann auf dem Rückweg überfallen. Dann hättet Ihr es tief bereut, nicht bei mir geblieben zu sein. Die wichtigste Zeit war also die Zeit, in der Ihr die Beete ausgehoben habt, die wichtigste Person war ich, und die wichtigste Aufgabe bestand darin, mir zu helfen. Als später der Verwundete hierher gerannt kam, war die wichtigste Zeit, die die Ihr mit dem Verbinden der Wunde zubrachtet, denn wenn Ihr ihn nicht gepflegt hättet, wäre er gestorben, und Ihr hättet die Möglichkeit versäumt, Euch mit ihm auszusöhnen. Wie schon zuvor war die wichtigste Person also er und die wichtigste Aufgabe bestand darin, seine Wunden zu versorgen. Denkt daran, es gibt nur eine wichtige Zeit und die ist JETZT. Der gegenwärtige Augenblick ist die einzige Zeit, über die wir verfügen. Und die wichtigste Person, ist immer der Mensch mit dem Ihr gerade beisammen seid, der unmittelbar vor Euch steht, denn wer weiß, ob Ihr in Zukunft noch mit irgendeinem Menschen zu tun haben werdet? Und die wichtigste Aufgabe besteht darin, den Menschen an Eurer Seite glücklich zu machen und darüber selbst euer Glück in euch zu finden. Das allein ist Sinn und Zweck des Lebens. «
Es gibt nur eine wichtige Zeit und die ist JETZT.
Frei nach Ajahn Brahm – die Geschichte von Leo Tolstoi
Fußspuren
Ein Mann lag schon einige Wochen auf dem Krankenbett und die Ungeduld, zu genesen, wieder ein ganzer Mensch zu sein, wuchs von Tag zu Tag.
Da hatte er eines Nachts folgenden Traum: Er ging in seinem Traum mit Gott am Strand des Meeres spazieren. Am Himmel zogen Szenen aus seinem Leben vorbei. Für jede Szene waren die Spuren im Sand zu sehen. Er blickte auf die Fußspuren im Sand zurück und sah, dass manchmal zwei, manchmal aber nur eine Spur im Sand war. Weiter bemerkte er, dass diese eine Spur mit den Szenen aus größter Not und Traurigkeit in seinem Leben zusammenfiel.
Deshalb sprach er zu Gott: „Herr, ich habe bemerkt, dass zu den traurigsten Zeiten meines Lebens nur eine Fußspur zu sehen ist. Du hast aber versprochen, stets bei mir zu sein. Ich versteh nicht, warum du mich da, wo ich dich am nötigsten hatte, allein gelassen hast?“
Da antwortete der Herr: „Mein lieber Sohn, ich habe dich lieb und würde dich niemals verlassen. In den Tagen, wo du nur eine Fußspur siehst, hast du am meisten gelitten und du hast mich an diesen Tagen am nötigsten gebraucht. Da, wo du nur eine einzige Fußspur siehst, das war an den Tagen, wo ich dich getragen habe!“
Quelle: unbekannt
Die Kuh Gloria
Die Kuh Gloria war schon als Kind dicker als alle anderen Kühe. Und das steigerte sich noch, je älter sie wurde. Ihre Lippen waren fleischig, ihre Nase breit, der Kopf war riesig wie ein Kürbis, eigentlich noch größer, und dazu hatte sie sehr starke Beine, einen dicken Bauch, grobe, borstige Haare und plumpe Füße.
Weil es keine Kleider in ihrer Größe zu kaufen gab, musste sie alles selber nähen, und das tat sie ohne guten Geschmack und ohne großes Geschick. Darum sah sie auch in ihren handgeschneiderten Kleidern noch mäßiger aus, als sie in Wirklichkeit war. Sie hatte einen Gang wie ein Trampeltier, und wenn sie sprach, klang es, als ob man in ein leeres Regenfass brüllte.
Diese Kuh dachte nicht daran, bescheiden zu sein wie alle anderen Kühe ihres Jahrgangs und eine gute Milchkuh zu werden. Nein, sie war ehrgeizig und wollte etwas Höheres! Irgendein Spaßvogel, ich nehme an, es war der Fuchs, hatte ihr gesagt, sie habe so eine schöne Stimme, sie solle sich doch als Sängerin ausbilden lassen. Und da sie einen reichen Vater hatte, der alles bezahlte, nahm sie Musikstunden und gab dann auch ein Konzert. Alle Kühe kamen, um Gloria singen zu hören. Sie sang zuerst das Lied vom Veilchen am Wegesrand, und das war auch zugleich das letzte Lied, das sie bei ihrem Konzert sang.
Denn wenn ihre Stimme beim Reden klang, als käme sie aus der Regentonne, so klang sie beim Singen, als wenn zwei Elefanten mit dem Rüssel in eine Gießkanne trompeten, während eine Säge gleichzeitig dünnes Blech zerschneidet. Die Zuhörer hielten sich die Ohren zu, pfiffen, schrien und trampelten, um den fürchterlichen Gesang nicht hören zu müssen, oder rannten scharenweise von der Wiese, wo das Konzert stattfand. Die Kuh Gloria hörte auf zu singen und begann zu weinen. Alle Kühe dachten: Jetzt wird sie eine brave Milchkuh werden!
Aber nein – sie nahm Tanzstunden und wollte nun ihr Glück als Tänzerin versuchen!
Als sie zum ersten Mal vor den anderen Kühen tanzte, waren noch mehr gekommen, um Gloria zu sehen, als vorher zu ihrem Konzert. Sie kam auf die Bühne in einem Tanzröckchen, so groß, dass man daraus bequem sieben Tischtücher hätte machen können, stolperte schon beim ersten Schritt und fiel über ihre eigenen Füße. Die Zuschauerkühe lachten, aber Gloria ließ sich nicht beirren und machte einen Tanzsprung. Dabei brachen die Bühnenbretter unter ihrem Gewicht, und sie sank bis an die Arme ein. Die Zuschauer lachten wieder, aber fünf starke Ochsen stiegen auf die Bühne und halfen ihr aus dem Loch, worauf sie weitertanzte. Allerdings tanzte sie zu nahe an den Bühnenrand, verlor das Gleichgewicht und stürzte von der Bühne direkt auf die Musiker, die im Orchesterraum saßen und zu ihrem Tanz aufspielten. Als sie sich mühsam wieder erhob, war die Bassgeige zerbrochen, die Trompete flach gedrückt, das Trommelfell zerplatzt, die Handharmonika war entzweigerissen, und den Dirigentenstock hatte der Musikdirektor vor Schreck verschluckt.
Man kann sich denken, wie die Zuschauer lachten, als die Tänzerin hinter dem Vorhang verschwand. Daraufhin wanderte die Kuh Gloria, die sich sehr schämte, ins Nilpferdland aus, zu den dicken Nilpferden. Dort tanzte sie vor den plumpen Tieren und sang dazu ihre Lieder.
Und am nächsten Tag las man in der Nilpferdzeitung: »Die Künstlerin Gloria, ein zartes, zerbrechliches Persönchen, gab gestern Abend ein Konzert und tanzte dazu. Noch nie hat man hier so eine reine und helle Stimme bewundern dürfen, noch nie hat man so schönen Gesang gehört. Dazu tanzte, oder besser gesagt, schwebte die Künstlerin wie eine Elfe über die Bühne, und alle unsere Nilpferdmädchen im Saal waren hingerissen von ihrer Leichtigkeit. Hoffentlich tanzt und singt die Künstlerin Gloria noch oft bei uns im Nilpferdland!«
Paul Maar
Lachgesichter in der Griesgram-Straße
Seit kurzem wohnt Peter in der Griesgram-Straße. Natürlich heißt diese Straße anders, aber Peter hat ihr diesen Namen gegeben, weil die Leute alle so griesgrämig dreinblicken. Selbst die Kinder sind abweisend und feindselig und Peter traut sich nicht sie anzusprechen. So ist er nachmittags immer alleine und langweilt sich. .
In einer Nacht träumt Peter von bunten Lachgesichtern. Sie stehen überall in den Fenstern und lachen hell und bunt auf die dunkle Griesgram-Straße hinaus. Es ist ein schöner Traum. Am nächsten Tag muss Peter immer wieder an die Lachgesichter denken. Ab und zu huscht sogar ein Lächeln über sein Gesicht. Und auf einmal hat er eine Idee: Er wird sich so ein buntes Lachgesicht basteln! Wie in seinem Traum soll es fröhlich auf die Straße hinauslachen.
Als Peter an diesem Tag nach Hause kommt, lässt er die Langeweile einfach vor der Haustür stehen. Aus Pappe und Leuchtpapier bastelt er ein Lachgesicht und klebt es ans Fenster. Und als es draußen dämmert, stellt er vorsichtig auch eine brennende Kerze aufs Fensterbrett. „Das sieht lustig aus!“ denkt er.
Peters Eltern staunen, als sie von der Arbeit kommen. Ein buntes Lachen leuchtet ihnen schon von weitem entgegen. »Wie schön!«, freuen sie sich.
Auch ein paar Griesgram-Straßen Bewohner bleiben überrascht vor dem Lachgesicht stehen. »Na so was!«, brummt einer, und ein anderer meint muffig: »Was gibt es denn heutzutage noch zu lachen?«
Am nächsten Abend leuchten drei Lachgesichter den Griesgram Straßen Bewohnern entgegen: Eines von Peters Fenster, eines vom Fenster des Nachbarhauses und ein anderes vom Haus gegenüber. Und während sich die Leute noch mehr wundern, freut sich Peter wie ein Schneekönig. Ja, er lacht selbst so fröhlich wie sein Lachgesicht. „Vielleicht, ja vielleicht würde ja doch noch alles gut werden!“ Und gespannt wartet er auf den nächsten Abend. Wie viele Lachgesichter würden dann wohl auf die gar nicht mehr so griesgrämige Griesgram-Straße hinauslachen?
Nun, ich kann es euch verraten: Von Tag zu Tag sind es mehr geworden, und von Tag zu Tag haben sich auch mehr Griesgram-Straßen-Kinder zugelächelt. Und wie die Geschichte weitergeht, kannst du dir denken.
Elke Bräunling
Richte deine Aufmerksamkeit
Es kam ein Patient zum Arzt und klagte: „Angst beherrscht mein Leben. Sie hat mir alle Freude genommen.“
Der Arzt erzählte dem Patienten darauf eine kleine Geschichte:
„Hier in meiner Praxis lebt eine Maus, die an meinen Büchern knabbert. Mache ich zu viel Aufhebens von der Maus, wird sie sich vor mir verstecken und ich werde nichts Anderes mehr tun, als sie zu jagen. Stattdessen habe ich meine wertvollsten Bücher an einen sicheren Platz gestellt und ich erlaube ihr, an den anderen zu knabbern.
Auf diese Weise bleibt sie eine einfache, kleine Maus und wird nicht zu einem Monster.
Mein Rat lautet also: Richte deine Angst auf einige wenige Dinge, dann bleib Dir Mut für das, was wichtig ist.“
frei nach Khalil Gibran
Der Tempel der tausend Spiegel
Es gab in Indien den Tempel der tausend Spiegel. Er lag hoch oben auf einem Berg und sein Anblick war gewaltig. Eines Tages kam ein Hund und erklomm den Berg. Er stieg die Stufen des Tempels hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel.
Als er in den Saal der tausend Spiegel kam, sah er tausend Hunde. Er bekam Angst, sträubte das Nackenfell, klemmte den Schwanz zwischen die Beine, knurrte furchtbar und fletschte die Zähne. Und tausend Hunde sträubten das Nackenfell, klemmten die Schwänze zwischen die Beine, knurrten furchtbar und fletschten die Zähne.
Voller Panik rannte der Hund aus dem Tempel und glaubte von nun an, dass die ganze Welt aus knurrenden, gefährlichen und bedrohlichen Hunden bestehe.
Einige Zeit später kam ein anderer Hund, der den Berg erklomm. Auch er stieg die Stufen hinauf und betrat den Tempel der tausend Spiegel. Als er in den Saal mit den tausend Spiegeln kam, sah auch er tausend andere Hunde. Er aber freute sich. Er wedelte mit dem Schwanz, sprang fröhlich hin und her und forderte die Hunde zum Spielen auf.
Dieser Hund verließ den Tempel mit der Überzeugung, dass die ganze Welt aus netten, freundlichen Hunden bestehe, die ihm wohlgesonnen sind.
gefunden: Erfolgsprinzipien der Optimisten von Nikolaus B. Engelmann
Ein Sprung in der Schüssel
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei alte große Wasserschüsseln besaß. Diese hingen rechts und links an einer langen Holzstange, die sie dazu auf ihren Schultern trug. Eine der beiden Schüsseln hatte einen Sprung.
Immer, wenn die alte Frau vom Fluss, vom Wasserholen zurückkam, hatte sie nur anderthalb Schüsseln mit Wasser nach Hause gebraucht.
Die makellose Schüssel war sehr stolz auf ihre Leistung. Die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich aber wegen ihres Makels und war sehr betrübt darüber, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkam, sprach die Schüssel zu der alten Frau: „Ich schäme mich so wegen meines Sprunges, aus dem den ganzen Weg über bis hin zu deinem Haus, immer das Wasser ausläuft.“
Die alte Frau lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf der einen Seite des Weges Blumen blühen und auf der anderen Seite des Weges nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deiner Besonderheit bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken.
Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Hause beehren.
„Jeder von uns hat eigene Defizite und Makel, die uns einzigartig machen, das macht unser Leben interessanter.“
(Autor unbekannt, frei nach einer asiatischen Weisheit) gefunden bei erkenntnisweg.de
Geschichte von den Glücksbohnen
Wir richten oft unseren Blick nur auf Negatives, Glücksmomente gehen unter oder werden gar nicht wahrgenommen. Diese Geschichte und die entsprechende Übung dient der Wahrnehmungssteigerung, der Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Positive, sowie der Steigerung der Fremdfähigkeit. Vielleicht haben Sie Lust, das Experiment zu machen und Ihre Wahrnehmung auf das Positive -> DENKEN – FÜHLEN – HANDELN <- zu richten.
Sie brauchen dazu nur eine Handvoll Bohnen, Perlen oder ähnliches
Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihm etwas Freude bereitet oder er einen Glücksmoment empfunden hatte, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte.
Am Anfang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit einem Nachbarn – immer wanderte eine Bohne von der linken in die rechte Tasche.
Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche. Und bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich schlief er ein – auch wenn er nur eine Bohne in seiner rechten Hosentasche hatte.
Missverständnisse
Es war einmal ein lauer Sommerabend, da saßen die beiden ältlichen Schwestern Stina und Lisa in ihren Schaukelstühlen auf der Veranda ihres Hauses und schauten in die Weite des Abends. Während sie gemütlich vor sich hin schaukelten, lauschte Stina dem Chor, der in der nahen Dorfkirche probte. Der Chor sang eines ihrer Lieblingslieder. Stina blickte die Straße entlang, wo das Licht der kleinen bunten Glasfenster der Kirche das Abendlicht in Farbe setzte und sagte leise zu ihrer Schwester: „ Ist das nicht die schönste Musik, die es gibt?
Ihre Schwester Lisa, die währenddessen neben ihr auf ihrem Schaukelstuhl gemütlich vor sich hin- und her schaukelte, blickte zufällig auf die wilde Wiese, die sich neben dem Haus befand und lauschte dem Zirpen der Grillen.
Sie lächelte ganz beseelt und antwortete: „ Ja, du hast Recht, es ist eine herrliche Musik! Und dabei sollen sie das machen, indem sie ihre Hinterbeine aneinander reiben!“
Frei nach R.Moore
Vom hässlichen Entlein und dem schönen Schwan
Es war einmal eine wunderschöne Entenmutter mit glänzendem Gefieder, die brütete, in ihrem Nest am Dorfteich drei Eier aus. Aus den ersten beiden Eiern schlüpften eines Tages zwei wunderschöne Entenküken mit hell gelben flauschigem Federn. Nur aus dem letzten Ei schlüpfte ein Küken, mit hellgrauen zerzausten Federn. Die Entenmutter schaute ganz verdutzt und enttäuscht auf das graue Küken und fragte sich, „Wie kann das nur sein?“ Keiner schien eine Antwort zu wissen.
Das hässliche Entlein erfuhr in seinen ersten Lebenstagen von seinen Geschwistern und den anderen Teichbewohnern nur Hohn und Spott. Besonders schämte sich das graue Küken, wenn es tollpatschig hinter seinen viel schnelleren gelben Geschwisterküken zum Teich watschelte. Wenn es sich dabei noch beobachtet fühlte, wurde dieses Gefühl noch verstärkt und oftmals stolperte das graue Küken vor lauter Scharm auch noch. Ach was schämte sich das graue hässliche Küken nur vor all den anderen für sein Aussehen und seine Andersartigkeit.
Jeden Morgen, bevor die anderen Tiere wach wurden, ging das kleine graue Entlein hinunter zum Teich, um im Wasser sein Spiegelbild zu sehen. Es registrierte, dass die anderen Recht hatten, es war grau und hässlich. So zog sich das kleine Entlein Tag für Tag weiter zurück, um dem Gespött der anderen Teichbewohner zu entgehen.
Doch eines Morgens, als das Entlein wieder mal alleine am Teich war, traf es eine kleine graue Raupe. Die Raupe fragte sie: „Warum bist du denn so traurig?“ „Weil ich so hässlich bin!“ antwortete das Entlein „ Warum kann ich nicht so, wie alle anderen sein ?“ – Die Raupe schaute überrascht und entgegnete: „Du willst so, wie alle anderen sein? – Dann bist du doch nur eine von vielen. Es ist doch viel besser etwas Besonderes und Einzigartiges zu sein! – Es stimmt! Du bist nicht gelb und flauschig wie die anderen deiner Art. Du bist grau und damit bist du etwas Besonderes! Glaub an dich, dann wirst du schöner sein als alle anderen!“ Mit diesen Worten kroch die Raupe davon.
Das graue Entlein dachte noch lange und intensiv über die Worte der kleinen Raupe nach und fasste den Entschluss: „Die Raupe hat Recht! Ich bin nicht hässlich! Ich werde mich nicht länger verspotten und kleinmachen lassen. Ich werde zu mir selbst stehen!“ Mit diesen Gedanken schlief das Entlein erleichtert ein.
Am nächsten Morgen wachte das Entlein mit einem Lächeln im Gesicht auf und ging ganz gelassen und selbstbewusst mit stolzem Haupt zu den anderen. „Ach, war das ein schönes Gefühl – sich selbst zu vertrauen!“ Es sah den anderen Enten ins Gesicht und sah gar keinen Spott, sondern Anerkennung und Bewunderung. Das Entlein freute sich sehr, dass sein positives und selbstsicheres Auftreten scheinbar unmittelbare Wirkung zeigte. Es ging zum Teich und blickte gedankenverloren ins Wasser. Die Teichoberfläche zeigte ihm sein Spiegelbild – das Entlein konnte es zuerst gar nicht glauben, was es da sah: An Stelle eines kleinen grauen hässlichen Entleins, sah es nun einen wunderschöner, schneeweißer Schwan. Die Raupe hatte Recht. Der Glaube an sich selbst macht einen schöner als alle anderen!
(freie Erzählung nach Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Die Geschichte von den mangelhaften Backsteinen
DIE GESCHICHTE VON DEN MANGELHAFTEN BACKSTEINEN
Die Mönche brauchten ein Dach über dem Kopf, hatte aber kein Geld um sich ein Gebäude bauen zu lassen, also legten sie selbst Hand an. Sie hatten das Mauern nicht gelernt, gaben sich dennoch sehr viel Mühe und Geduld. Sie gaben sich sehr viel Mühe die Steine perfekt einzupassen. Und irgendwann war die Backsteinmauer fertig.
Voller Stolz trat der eine Mönch einen Schritt zurück, um mein Werk zu begutachten. Erst da fiel ihm auf, dass zwei Backsteine das Regelmaß störten. Alle anderen Steine waren ordentlich zusammengesetzt worden, aber zwei saßen schief. Der Mönch sagte enttäuscht zu sich,“diese zwei Steine haben mir die ganze Mauer versau!“ Der Zementmörtel war inzwischen fest geworden. Also konnte man diese Steine nicht einfach herausziehen und ersetzen. Der Mönch ging zu meinem Abt und fragte, ob er die Mauer niederreißen und neu anfangen dürfe. „Nein“, erwiderte der Abt, „die Mauer bleibt so stehen, wie sie ist.“
Als der Mönch die ersten Besucher durch unser neues Kloster führte, vermied er es stets, mit ihnen an dieser Mauer vorbeizugehen. Er hasste den Gedanken, dass jemand dieses Stümperwerk sehen könne. Etwa drei oder vier Monate später wanderte der Mönch mit einem Gast über das Terrain. Plötzlich fiel der Blick des Gastes auf die Schandmauer.
„Das ist aber eine schöne Mauer!“, bemerkte der Gast wie nebenbei. „Sir, erwiderte der Mönch überrascht, „haben Sie etwa Ihre Brille im Auto vergessen? Oder einen Sehfehler? Fallen Ihnen denn die zwei schief eingesetzten Backsteine nicht auf, die die ganze Mauer verschandeln?“
Die nächsten Worte des Gastes veränderten die Einstellung des Mönchs zu seiner Mauer, zu sich selbst und zu vielen Aspekten des Lebens.
„Ja“, sagte der Gast, „Ich sehe die beiden mangelhaft ausgerichteten Backsteine. Aber ich sehe auch 998 gut eingesetzte Steine.“
Der Mönch war überwältigt. Zum ersten Mal seit drei Monaten sah er neben den beiden mangelhaften Steinen auch die anderen Backsteine. Oberhalb und unterhalb der schiefen Steine, zu ihrer Linken und zu ihrer Rechten befanden sich perfekte Steine, ganz gerade eingesetzt. Ihre Zahl überwog die der schlechten Steine bei weitem.
Bis dahin hatte er sich ausschließlich auf seine beiden Fehler konzentriert und war allem anderen gegenüber blind gewesen, deshalb konnte er den Anblick der Mauer auch nicht ertragen und wollte ihn anderen Menschen auch nicht zumuten. Deshalb hatte er das Werk vernichten wollen. Doch als der Mönch jetzt die ordentlichen Backsteine betrachtete, schien die Mauer überhaupt nicht mehr grauenvoll auszusehen. Der Besucher hatte schon Recht: Es war wirklich eine sehr schöne Mauer.
Und zwanzig Jahre später, steht sie immer noch, und inzwischen hat der Mönch längst vergessen, an welcher Stelle die mangelhaften Backsteine stecken, er kann sie mittlerweile wirklich nicht mehr sehen.
Frei nach Ajahn Brahms
Die Kuh, die weinte
Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück.
Löwengeschichte
LÖWENGESCHICHTE
Es war einmal ein Löwe, der in einer ständig vom Wind durchwehten Wüste lebte; die Teiche und Flussläufe, aus denen er trank, waren niemals ruhig und glatt, denn der Wind kräuselte die Oberfläche, die deshalb niemals etwas reflektierte. Eines Tages wanderte der Löwe in einen Wald, wo er jagte und sich vergnügte, bis er sich müde und durstig fühlte. Auf der Suche nach Wasser fand er einen Teich mit dem kühlsten, verlockendsten und stillsten Wasser, das man sich vorstellen kann. Löwen können nämlich wie andere Wildtiere auch Wasser riechen, und der Geruch dieses Wassers übertraf alles, was er bisher gerochen hatte, Der Löwe näherte sich dem Wasser und reckte seinen Schädel, um zu saufen. Plötzlich sah er sein Spiegelbild im Wasser— und hielt es für einen anderen Löwen. «O Mann», dachte er bei sich selbst, «das Wasser gehört wohl einem anderen Löwen — Vorsicht ist angebracht.» Er zog sich zurück, aber der Durst trieb ihn wieder zum Wasser, und ein zweites Mal sah er den Kopf eines Furcht erregenden Löwen, der ihn aus dem Wasser anblickte. Diesmal hoffte der Löwe, er könnte den anderen Löwen verscheuchen; und so riss er sein Maul auf- und ließ ein gewaltiges Gebrüll erschallen. Aber kaum hatte er seine Zähne gefletscht, als der andere Löwe natürlich ebenfalls seinen Rachen aufriss und das schien unserem Löwen ein schrecklicher und gefährlicher Anblick zu sein. Ein ums andere Mal scheute der Löwe zurück und näherte sich dann wieder dem Teich. Und ein ums andere Mal machte er dieselbe Erfahrung. Nach einer langen. Zeit war er jedoch so durstig geworden und verzweifelt, dass er beschloss: «Löwe hin, Löwe her – ich werde jetzt von diesem Teich trinken.» Und wahrlich, kaum hatte er sein Gesicht ins Wasser getaucht, als der andere Löwe verschwand!
Eine orientalische Geschichte
Bernhard Trenkle
Das Herz des Adlers
DAS HERZ DES ADLERS
Ein Bauer findet einen aus dem Nest gefallenen Jungadler, der hilflos hin und her hüpft. Beinahe wäre er verhungert. Der Bauer nimmt ihn mit und setzt ihn zuhause in seinen Hühnerstall, wo er zusammen mit den Küken aufwächst. Er lernt, sich wie ein Huhn zu verhalten, und wird auch vom Bauern wie ein Huhn behandelt: Körnerpicken, Eierlegen und ab und zu vom Hahn beglückt werden.
Eines Tages – 5 Jahre sind nun schon so vergangen – bekommt unser Bauer Besuch von seinem Freund, einem Vogelfachmann. Als die beiden im Garten spazieren gehen, sagt der Freund zu dem Bauern:: „Der Vogel da, ist doch kein Huhn! Das ist ja ein Adler!“ „Mag sein“, erwidert der Bauer, „,ja, er war mal ein Adler, aber ich habe ihn großgezogen, so als wenn er ein Huhn wäre. Nach all den Jahren ist er kein Adler mehr, jetzt ist er ein Huhn geworden, wie jede Henne sonst auch – selbst wenn er Flügel mit einer Spannweite von 3 m hat.“ „Nein“ sagt der Ornithologe, „er ist ein Adler und wird immer ein Adler bleiben, in ihm steckt das Herz eines Adlers, und das wird ihn treiben, hoch in den Himmel zu fliegen.“
Also beschließen die beiden, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Der Vogelfachmann nimmt den Adler, hebt ihn hoch und redet auf ihn ein: „Weil Du ein Adler bist, weil Du dem Himmel gehörst und nicht der Erde, öffne Deine Flügel und flieg!“ Doch der Adler bleibt auf dem ausgestreckten Arm des Ornithologen sitzen. Ein wenig verstört schaut er ringsum. Als er die Hühner auf dem Boden sieht, wie sie scharren und Mais picken, springt er wieder zu ihnen zurück. „Habe ich es dir nicht gesagt,“ triumphierte der Bauer: „Der ist schlicht und einfach ein Huhn geworden.“ „Kann doch nicht sein!“ hält der Vogelfachmann dagegen: „Dein Huhn ist ein Adler und wird immer ein Adler bleiben, lass es uns morgen nochmal versuchen.“ Am nächsten Tag steigt der Ornithologe mit dem Adler auf das Dach des Hauses. Flüsternd beschwört er ihn: „Adler, Du wirst nie aufhören Adler zu sein, Du bist für die Freiheit geschaffen und nicht für den Hühnerstall. Breite Deine Flügel aus und flieg in die Höhe!“ Doch sobald der Adler die Hühner unter sich sieht, fliegt er wieder zu ihnen auf die Erde. Den Bauern freut das und erneut fühlt er sich bestätigt: „Hab ich Dir nicht gesagt, das Vieh ist ein Huhn geworden!“ Unser Vogelfachmann lässt nicht locker. „Nein, nie und nimmer, der ist ein Adler und wird immer das Herz eines Adlers haben. Lass es uns noch ein letztes Mal versuchen. Morgen bringe ich ihn zum Fliegen.‘‘
Am nächsten Morgen stehen Bauer und Ornithologe in aller Frühe auf. Sie nehmen den Adler und gehen mit ihm aus der Stadt hinaus. Dann wenden sie sich dem Gebirge zu und steigen auf den höchsten Gipfel. Am Horizont geht gerade die goldene Morgensonne auf. Da hebt der Vogelfachmann den Adler in die Höhe und befiehlt ihm: „Adler, wach auf aus dem Schlaf, gib deiner wahren Natur die Freiheit, öffne deine mächtigen Schwingen und flieg!“ Der Adler schaut um sich, er bebt am ganzen Körper, als ob neues Leben in ihn einströmt, aber – er fliegt nicht. Da fasst der Mann ihn kräftig an und hält seinen Kopf direkt in die Sonne. Die Augen des Adlers füllen sich mit dem Glanz der Sonne und mit der grenzenlosen Weite. In dem Augenblick öffnet er seine mächtigen Flügel, stößt das aller erste Mal in seinem Leben den Schrei eines Adlers aus und beginnt zu fliegen – und zu fliegen und zu fliegen. Er fliegt in die Weite des unendlichen Himmels, der aufgehenden Sonne entgegen.
Stille
STILLE
Die Meditationsschüler fragen ihren Meister, wozu denn Stille gut sein soll, wo doch Stille eigentlich nichts ist. Der Meister weist die Schüler an, einen Stein in den Brunnen zu werfen und zu beschreiben, was sie wahrnehmen. Die Schüler sagen: „Wir sehen Wellen, Kreise, Bewegung. Wir spüren die Kraft des Wassers, wie es am Brunnen hochsteigt. Und wir hören das Platschen des Steines, wenn er die Wasseroberfläche durchdringt.“ Danach bittet der Meister die Schüler zu warten, bis das Wasser wieder vollkommen zur Ruhe gekommen ist. Er fragt: „Nun, was erblickt Ihr jetzt, wenn Ihr in den Brunnen schaut?“ Und die Schüler antworten ganz erstaunt: „Uns selbst. Jetzt wo alles ganz still ist, können wir uns selber sehen!“
Angst vor Veränderung
ANGST VOR VERÄNDERUNG
Es waren einmal zwei Zwillingsbrüder, die wuchsen langsam im Bauch ihrer Mutter heran. Die Wochen vergingen und die Knaben wurden größer und größer.
Beide dachten, „wie großartig, dass wir bald geboren werden1“
Die Zwillinge begannen ihre Welt zu entdecken. Als sie die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und ihnen Nahrung gab, sangen und tanzten sie vor Freude: „Wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt!“
Als die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. „Was soll das heißen?“ fragte der eine. „Das heißt“, antwortete ihm der andere, „dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht.“ „Aber ich will nicht gehen“, erwiderte der eine, „ich möchte für immer hierbleiben.“ „Wir haben keine andere Wahl“, entgegnete der andere, „aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt!“ „Wie könnte diese sein?“, wir werden unsere Lebensschnur verlieren, und wie sollten wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß verlassen, und niemand von ihnen ist hierher zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. – Nein, dies ist das Ende!“ So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte: „Wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Schoß? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter allem.“ „Aber sie muss existieren“. protestierte der andere. „Wie sollten wir sonst hierhergekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben?“ „Hast du je unsere Mutter gesehen?“ fragte der eine. „Womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen können.“ Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter erfüllt mit vielen Fragen und großer Angst.
Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie die Augen. Und was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume …
Tucholsky, alias P. Panter, T. Tiger,
Der Schatz am Rande des Regenbogens
Es war einmal ein alter Mann. Der lebte ganz allein im Wald in einer kleinen Hütte und wahr sehr, sehr unglücklich. Jeden Tag saß er auf einer Bank vor seinem Häuschen und starrte vor sich hin. Erhörte nicht wie die Vögel sangen, er spürte den Wind nicht, der mit den Blättern der Bäume spielte, er fühlte nicht die Sonnenstrahlen auf seiner Haut, er roch den würzigen Tannenduft nicht, und er sah nicht, wie die Tiere des Waldes immer wieder zutraulich herankamen.
Er hielt den lieben langen Tag den Kopf gesenkt und dachte nach. Seine Gedanken kreisten immer nur um eine Sache. Warum, so fragte er sich wieder und wieder, warum nur war die Prophezeiung der schönen Fee nicht in Erfüllung gegangen? Dabei war der Fall doch ganz klar. Seine Mutter hatte ihm die Geschichte oft erzählt. Damals, als er vor vielen Jahren in dem tausend Jahre alten Wasserschloss, in der Mitte des Waldsees geboren wurde, damals, genau eine Stunde nach der Geburt, hatte plötzlich eine Fee an seiner Wiege gestanden.
Sie hatte wunderschöne lange Haare, erinnerte sich seine Mutter. Fein und schimmernd wie Spinnweben, auf die die Sonne scheint. Und sie hatte ein Lächeln auf den Lippen, das jeden, ob Mann oder Frau, dahinschmelzen ließ. Was die Fee dann gesagt hatte, das hat sich der Mann genau gemerkt, zu oft hatte es ihm seine Mutter, die nun natürlich längst gestorben war, wiederholen müssen. Am Ende des Regenbogens liegt ein großer Schatz für dich. Genau diese Worte hatte die Fee zu dem Säugling gesprochen. Dann war sie verschwunden.
Kaum war er alt genug, hatte der Mann auf der ganzen Welt nach diesem Schatz geforscht. Er war von Land zu Land gereist, hatte in den Bergen nach Edelsteinen, in den Flüssen nach Gold gesucht, und er war nach versunkenen Schiffen auf den Meeresgrund getaucht. Es war ein wildes, abenteuerliches Leben gewesen, voller Ungeduld und Gier. Doch den Schatz, nein, den hatte er nie gefunden. Er war arm wie eine Kirchenmaus geblieben, und sein Erbe, das schöne Wasserschloss, fiel an seinen jüngeren Bruder, weil er sich nie darum gekümmert hatte.
„Am Ende des Regenbogens, so ein Unsinn!“ pflegte er regelmäßig am Ende seiner Grübelein zu sagen und missmutig in die Hütte zurückzustampfen, um sich schlafen zu legen.
So lebte er dahin, bis eines Tages etwas geschah. Es hatte tagelang geregnet, doch plötzlich war mit Macht die Sonne durchgebrochen, obwohl es noch etwas nieselte. Der alte Mann saß mal wieder mit gesenktem Kopf vor seiner Hütte und zertrat wütend eine kleine Blume. Doch plötzlich veränderte sich das Licht, und der alte Mann schreckte auf. Und da sah er es. Ein riesiger Regenbogen spannte sich über den Wald, hoch über die höchsten Wipfel der Bäume. Ein Regenbogen in den schönsten Farben, so prächtig, wie er es noch nie gesehen hatte. Und das Ende des Regenbogen zeigte genau auf ihn.
Ja, der alte Mann saß direkt am Ende des Regenbogens. Da kam ihm die Erleuchtung. Der Schatz am Ende des Regenbogens, das war er selber. Der alte Mann begann zu weinen. Er ging in seine Hütte und weinte drei Tage und drei Nächte lang.
Dann trat er wieder heraus. Er holte tief Luft und spürte, wie das Leben in ihn zurückströmte. Er fühlte sich um Jahrzehnte jünger. Er sah auf den Boden und bemerkte einen kleinen Käfer, der auf den Rücken gefallen war. Er bückte sich und drehte ihn behutsam herum. Dann blickte er hoch und nahm wahr, dass der Himmel leuchtend blau war.
Da wusste er, dass ein langes, glückliches Leben vor ihm lag.
Vom Wert der Dinge und der Menschen
Im Rahmen eines Workshops hielt der Trainer einen 50-Euro-Schein in die Luft. Er fragte: „Wer von Ihnen möchte diesen 50-Euro-Schein haben?“ Überall gingen Hände hoch. „Ok, einen kleinen Moment“, sagte er und zerknüllte den 50-Euro.Schein. „Wer möchte diesen nun zerknüllten 50-Euro-Schein haben?“ Wieder gingen die Hände in die Luft. „Ok, warten Sie“, sagte er und warf den zerknüllten 50-Euro-Schein auf den Boden und trat mit seinen Schuhen darauf herum, bis der Schein zerknittert und voller Schmutz war. Er hob ihn an einer Ecke auf und hielt ihn wieder in die Luft. „Und wer von Ihnen möchte diesen dreckigen, zerknitterten 50-Euro-Schein immer noch haben?“ Und erneut waren die Hände in der Luft.
„Sehen Sie, Sie haben gerade eine sehr wertvolle Lektion erfahren. Was immer ich auch mit dem Geldschein machte, wie schmutzig und zerknittert er auch ist, es hat nichts an seinem Wert geändert. Es sind immer noch 50,- Euro. So oft in unserem Leben werden wir selbst fallen gelassen, sind am Boden zerstört und kriechen vielleicht im Schmutz – und fühlen uns wertlos. Aber all das ändert ebenso wenig etwas an unserem Wert wie das, was ich mit diesem Schein tat, seinen Wert änderte. Der Wert von jedem einzelnen von uns bleibt immer erhalten, wie schmutzig, arm oder verloren wir auch immer sein werden.“
Das schöne Herz
Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich, und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm recht, es war wirklich das schönste Herz, was sie je gesehen hatten.
Der junge Mann war sehr stolz und prahlte lauter über sein schönes Herz. Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: „Nun, dein Herz ist nicht mal annähernd so schön, wie meines.“ Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben, es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig, und es gab einige ausgefranste Ecken. Genauer, an einigen Stellen waren tiefe Furchen, wo ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an: Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner, dachten sie? Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte: „Du musst scherzen“, sagte er, „dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.“
„Ja“, sagte der alte Mann, „deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau sind, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe geben heißt manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Und ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist?“
Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der alte Mann nahm das Angebot an und setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde des jungen Mannes Herzen. Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. Der junge Mann sah sein Herz an, nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite.
Ohne Quellenangabe
Die Samen
Es steckten einmal zwei Samen nebeneinander im Boden. Der erste Samen sprach: „Ich will wachsen! Ich will meine Wurzeln tief in die Erde senden, und ich will als kleines Pflänzchen die Erdkruste durchbrechen, um dann kräftig zu wachsen. Ich will meine Blätter entfalten und mit ihnen die Ankunft des Frühlings feiern. Ich will die Sonne spüren, mich von Wind hin- und herwehen lassen und den Morgentau auf mir spüren. Ich will wachsen!“ Und so wuchs der Samen zu einer kräftigen Pflanze.
Der zweite Samen sprach: „Ich fürchte mich. Wenn ich meine Wurzeln in den Boden sende, weiß ich nicht, was mich dort in der Tiefe erwartet. Ich befürchte, dass es mir wehtut oder dass mein Stamm Schaden nehmen könnte, wenn ich versuche, die Erdkruste zu durchbrechen. Ich weiß auch nicht, was dort oben über der Erde auf mich lauert. Es kann so viel geschehen, wenn ich wachse. Nein, ich bleibe lieber hier in Sicherheit und warte, bis es sicherer ist.“
Und so verblieb der Samen in der Erde und wartete. Eines Morgens kam eine Henne vorbei. Sie scharrte mit ihren scharfen Krallen nach etwas Essbaren im Boden. Nach einer Weile fand sie den wartenden Samen im Boden und fraß ihn auf.
Chickensoup for Soul